Ulrichs, Karl Heinrich
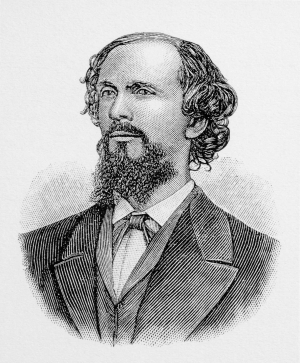
Karl Heinrich Ulrichs
Grafik [aus: Jb. f. sexuelle Zwischenstufen 1 (1899), S. 35]; als Vorlage diente eine überlieferte Porträtfotografie des Dargestellten.
© unbekannt. Die Grafik wurde in dem o. g. Jahrbuch ohne Angabe des Künstlers/der Künstlerin 1899 publiziert.
Ulrichs, Karl Heinrich. Psd.: Numa Numantius. Jurist. Journalist und Schriftsteller. „Homosexuellenaktivist“. * 28.8.1825 Gut Westerfeld bei Aurich/Ostfriesland, † 14.7.1895 Aquila (Italien).
Sohn des Landbaumeisters Hermann Heinrich U. (1784-1835) und dessen Frau Elise, geb. Heinrichs (1796-1856). Drei Geschwister, von denen zwei bereits im ersten Lebensjahr starben.
Nach dem Schulbesuch in Aurich, Detmold und Celle studierte U. von 1844 bis 1847 Jura an den Universitäten in Göttingen und Berlin. Anschließend war er sechs Jahre lang im Justiz- und Verwaltungsdienst des Königreichs Hannover tätig, zu dem damals sein ostfriesischer Geburtsort gehörte. Nachdem er Ende 1854 seinen Dienst als „Hülfsrichter“ in Hildesheim quittieren musste, um ein drohendes Disziplinarverfahren wegen „widernatürlicher Wollust“ abzuwenden, lebte U. als freier Autor und Journalist u. a. in Burgdorf bei Hannover, Ffm., Würzburg und Stuttgart, schließlich in Italien. In Ffm. wohnte er von Oktober 1859 bis März 1863, zunächst in der Schäfergasse 38, dann in der (Großen) Friedberger Straße 30 und schließlich im Reuterweg 10. Bereits Anfang 1860 trat er dem „Freien Deutschen Hochstift für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung“ bei, das wenige Monate zuvor als freie Akademie gegründet worden war. Nach eigenem Bekunden war das Hochstift „damals ein Sammelbecken für die vielfältigen Interessen selbstbewusster, liberal gesinnter Bürger“. U. war in Ffm. als Sekretär des Bundestagsgesandten Justin von Linde tätig und verfasste regelmäßig Berichte für die in Augsburg erscheinende Allgemeine Zeitung. Daneben beschäftigte er sich in verschiedenen Studien mit Fragen der Literatur, Mythologie und des öffentlichen Rechts.
Noch bevor das Wort „Homosexualität“ 1869 erfunden wurde, wurde U. zu einem frühen Vertreter der seinerzeit im Entstehen begriffenen Sexualwissenschaft und zu einem Vorläufer der erst Jahrzehnte nach seinem Tod erstarkenden emanzipatorischen Bürgerrechtsbewegung von Menschen, die heute meist unter dem Kürzel LSBTIQ zusammengefasst werden. Volkmar Sigusch prägte vor diesem Hintergrund die Bezeichnung „der erste Schwule der Weltgeschichte“ auf ihn. Vier Bekenntnisbriefe, die U. 1862 in Ffm. an seine Verwandten schrieb, wurden 1899 von dem Berliner Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1935) im „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ veröffentlicht. Schon in diesen Briefen sprach U. von einem „dritten Geschlecht“. Bahnbrechend waren U.’ zwölf Monographien über das „Räthsel der mannmännlichen Liebe“, die er von 1864 bis 1879 herausgab. Die ersten fünf Schriften in dieser Reihe veröffentlichte er unter dem Motto „Vincula frango“ (Ich zerbreche die Ketten) und mit Rücksicht auf seine Verwandten unter dem Pseudonym „Numa Numantius“; ab 1868 verbreitete er die Schriften unter seinem Klarnamen. U. war der erste, der eine moderne Theorie der „Homosexualität“ vorlegte und den „Homosexuellen“ als natürliches und gesundes Sexualsubjekt beschrieb. Später, im Zuge der Ausdifferenzierung seiner Theorie, unterschied er zwischen sieben größeren oder 13 kleineren Geschlechtern [unter ihnen Mannlinge, Weiblinge, Uranodioninge („Bisexuelle“), Zwittermänner und Zwitterweiber]. Er nahm für die Entwicklungsgeschichte des Menschen einen „embryonalen Urzwitter“ an, in dem vier „geschlechtliche Keime“ angelegt seien, drei körperliche und ein seelischer, und im Falle von „homosexuellen“ Männern sprach er von der „anima muliebris virili corpore inclusa“, einer in den männlichen Körper eingeschlossenen weiblichen Seele. Bei seinen Wortschöpfungen stützte sich U. auf Platons „Symposion“. Er nannte einen Mann, der Männer liebt, zunächst „Uranier“, später „Urning“ (nach der älteren Aphrodite oder „Venus Urania“, der mutterlosen Tochter des Himmelsgottes Uranos, die „nicht teilhat am Weiblichen“). Eine Frau, die eine Frau liebt, war für ihn eine „Uranierin“, „Urningin“ oder „Urnin“. Für U. war der „urnische“ Eros „von himmlischer Art und von höchstem Wert für den Staat wie für den Einzelnen, denn den Liebenden wie auch den Geliebten zwingt er dazu, mit allen Kräften nach der Tugend zu streben“. U. trat öffentlich für die Straffreiheit gleichgeschlechtlicher Beziehungen ein, forderte das Recht auf Ehe zwischen Menschen des gleichen Geschlechts und war der Überzeugung, dass, wenn die Wissenschaft erst einmal das Angeborensein der „urnischen“ Liebe anerkannt habe, der Kampf für die Menschenrechte gleichgeschlechtlich liebender Männer (und Frauen) gewonnen sei. Durch Zeitungsinserate, Leserbriefe und Eingaben stellte U. sich auch schützend vor „homosexuelle“ Angeklagte und Verurteilte seiner Zeit wie beispielsweise den Ffter Politiker und Dramatiker Johann Baptist von Schweitzer. U.’ Schriften erreichten seinerzeit interessierte Leser an so weit entfernten Orten wie St. Petersburg und St. Louis, so dass er schließlich mit „einer weitzerstreuten Schaar“ männerliebender Männer im Austausch stand.
Als Mitglied des Freien Deutschen Hochstifts in Ffm. zeigte sich U. als umtriebig und keinesfalls monothematisch orientiert, vor allem in den Anfangsjahren seiner Mitgliedschaft. In den Mitgliederakten sind 41 Einzelstücke erhalten, die U. betreffen. Die meisten stammen aus den Jahren 1860 und 1861. In den Vorschlägen, Anträgen und Eingaben, die U. dem Hochstift unterbreitete, geht es etwa um Fragen der Nahrungsmittelversorgung für die Bevölkerung, physikalische Probleme wie das „Aufsteigen des Wassers in nicht geschlossenem Raume“, das Verhältnis des deutschen zum böhmischen Volk, die deutsche Sprache, die „geistige Einheit“ aller Deutschen, die Unrechtmäßigkeit der Todesstrafe und den Erfinder der Schiffsschraube.
Gleichwohl wurde U. 1864 schon nach wenigen Jahren aus dem Hochstift ausgeschlossen, weil man sich durch ihn provoziert fühlte. Der Schriftführer der Akademie teilte U. am 5.4.1864 mit, er sei „wegen der gegen ihn obschwebenden criminellen Verfolgung“ nicht mehr als Mitglied zu betrachten. Wenige Monate zuvor war U. wegen des „Versuchs der widernatürlichen Unzucht“ steckbrieflich gesucht worden; der Steckbrief („Vorführungsbefehl“), allerdings auf den falschen Namen „Carl Anton Ulrichs“ ausgestellt, war am 19. und 21.11.1863 im „Amtsblatt der freien Stadt Fft.“ veröffentlicht worden. U. antwortete erst ein Jahr später auf den Ausschluss aus dem Hochstift, nachdem er die ersten fünf Monographien seiner „Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe“ in Druck gegeben hatte. Selbstbewusst brachte er vor: „Eine Ausschließung, welche erfolgt, ohne den auszuschließenden zuvor gehört zu haben, verstößt gegen die Fundamente alles positiven u(nd) moralischen Rechts.“ Daher erachtete er den Beschluss des Hochstifts als „null u(nd) nichtig“. Er verlangte, gehört zu werden, und zwar zum Inhalt der mitgesandten fünf Hefte seiner Forschungen. Das Hochstift aber wies U.’ Argumentation zurück und bekräftigte den Ausschluss. Da U. in seinen Schriften behauptet habe, es gebe neben den beiden bekannten Geschlechtern „noch eine besondere, denselben nicht angehörige Art von menschlichen Wesen, welche er Urninge nennt“, und er sich selbst zu dieser Menschengruppe zähle, die Satzung des Freien Deutschen Hochstifts aber zu einer „Mitgliedschaft dieser Wesen keine Erwähnung“ tue, könne er nicht Mitglied der Akademie bleiben. Im Übrigen wolle man sich „mit diesem, das Gefühl verletzenden Gegenstande“ nicht weiter befassen und verwahrte sich gegen weitere Zuschriften. Dennoch antwortete U. am 3.5.1865 gewandt und beherzt auf die neuerliche Abweisung. Er unterstrich, die Natur schaffe nicht zwei, sondern vier Geschlechter (gemeint waren der „Urning“ und die „Urnin“ neben den „normalgeschlechtlichen“ Männern und Frauen). Er sehe zwar ein, dass der Gegenstand das Gefühl verletze, doch wenn das Hochstift deswegen „mit dem Ausdruck der Verachtung zur Tagesordnung“ übergehen wolle, scheine ihm die Akademie „hinfort wohl eine anerkennenswerthe Anstalt für Gefühl u(nd) d(er)gl(eichen) zu sein“. Es dürfe aber fraglich sein, ob sie dann noch verdiene, den „hohen Namen ‚Hochstift für Wissenschaften‘ zu führen“, oder ob sie nicht das Wort „Wissenschaften“ aus ihrem Namen streichen müsse. Zudem, so U., sei es „engherzig“ und „ungerecht“, einen „Urning“ auszuschließen: „Es wäre das eine Intoleranz, horrender wahrlich, als sie in den finstersten Zeiten des Glaubenshasses gegen Ketzer u(nd) Juden je geübt worden ist! Darf man seinen Augen trauen? Ist das der Geist des 19ten Jahrhunderts? (…) Ist das des freien Deutschen Hochstifts würdig?“ Solche „Engherzigkeit“ müsste in letzter Konsequenz auch dazu führen, einen Platen, Winckelmann oder Alexander von Humboldt auszuschließen. U. deutete in seinem Brief ferner an, es gebe ein angesehenes Mitglied des Hochstifts, das ebenfalls „Urning“ sei, sich aber öffentlich noch nicht als solcher zu erkennen gegeben habe. Er erklärte sich gegebenenfalls bereit, dieses Mitglied beim Namen zu nennen. Das Hochstift ließ sich allerdings auch von dieser Androhung nicht beeindrucken. U.’ Mitgliedsakte wurde geschlossen, und jemand verzeichnete auf dem Aktendeckel den Warnhinweis „Urning“.
Nach seinem Wegzug aus Ffm. 1863 wurde U. zweimal verhaftet und schließlich aus Hannover ausgewiesen, nachdem er die Annexion seines Vaterlandes durch Preußen (1866) nicht hinnehmen wollte. Um diese Zeit wurde er in einer tumultartigen Szene von Kollegen niedergeschrien, als er sich auf dem Sechsten Deutschen Juristentag in München gegen die Strafbarkeit der männlichen „Homosexualität“ aussprach. Über die Ereignisse schrieb U. später: „Bis an meinen Tod werde ich es mir zum Ruhme anrechnen, daß ich am 29. August 1867 zu München in mir den Muth fand, Aug’ in Auge entgegenzutreten einer tausendjährigen, vieltausendköpfigen, wuthblickenden Hydra, welche mich und meine Naturgenossen wahrlich nur zu lange schon mit Gift und Geifer bespritzt hat, viele zum Selbstmord trieb, ihr Lebensglück allen vergiftete. Ja, ich bin stolz, daß ich die Kraft fand, der Hydra der öffentlichen Verachtung einen ersten Lanzenstoß in die Weichen zu versetzen.“
U. lebte bis 1870 in Würzburg, anschließend in Stuttgart. Nachdem Preußen im Zuge der Reichsgründung den „Schandparagraphen“ (§ 175 RStGB, der gleichgeschlechtliche Akte unter Männern mit Strafe belegte) auch vormals liberalen deutschen Ländern aufgezwungen hatte, verließ U. entmutigt und enttäuscht 1880 den deutschen Sprachraum und ging ins italienische Exil. Er ließ sich zunächst in Neapel nieder und zog von dort drei Jahre später nach Aquila (nordöstlich von Rom), wo er als Sprachlehrer seinen Lebensabend unter finanziell prekären Verhältnissen verbrachte.
U. war vielseitig gebildet und interessiert. Er verfasste preisgekrönte rechtswissenschaftliche Abhandlungen wie „Pax Westphalica quid constituerit de principum jure reformando religionisque exercitio subditorum“ (Der Westfälische Friede und seine Bestimmungen zur Reform des Rechts der Herrschenden und der Religionsausübung der Untertanen; ungedruckt) und „Fori reconventionis origines et doctrina“ (Ursprünge und Lehre von der gesetzlichen Behandlung der Wiedererlangung, 1846). Er beschäftigte sich u. a. mit dem Postmonopol von Thurn und Taxis, widmete eine Gedenkschrift dem bayerischen König Ludwig II. (1845-1886) und schrieb lateinische Studentenlieder, Matrosengeschichten und Gedichte. Von 1889 bis 1895 gab er die Zeitschrift „Alaudae“ („Die Lerchen“) in lateinischer Sprache heraus.
Bereits 1866 hatte U. die Zeitschrift „Uranus“ konzipiert. Auch wenn sie 1870 nur mit einem Heft erschien (in Form der Schrift „Prometheus“ in der Reihe „Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe“), kommt „Uranus“ eine besondere Bedeutung zu. Das geplante Periodikum mit dem Untertitel „Beiträge zur Erforschung des Naturräthsels des Uranismus und zur Erörterung der sittlichen und gesellschaftlichen Interessen des Urningsthums“ kann als erste „Homosexuellenzeitschrift“ der Welt angesehen werden. Sie sollte laut U. ein „Verfechter von Menschenwürde und Menschenrecht“ sein und „Urningen“ Orientierung und Halt bieten. Als Herausgeber und Autor ging U. unter Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Zuschriften von Lesern auf die Bibel ein, auf das Traumleben, aber auch auf Fälle von Erpressung. 1873 bekannte er: „Die Zeitschrift ‚Uranus‘ ist leider nicht ins Leben getreten: aus Mangel an Abonnenten.“ Realisiert wurde die Idee eines Periodikums für „Homosexuelle“ erst ein Vierteljahrhundert später, durch Adolf Brands Zeitschrift „Der Eigene“ (ab 1896) und Magnus Hirschfelds „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ (ab 1899). Hirschfeld war es auch, der drei Jahre nach dem Tod von U. dessen Schriften (mit einzelnen textlichen Änderungen) erstmals erneut herausgab.
Die zwölf Schriften in der Reihe „Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe“ sind: 1. „Vindex. Social-juristische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe“ (1864), 2. „Inclusa. Anthropologische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe“ (1864), 3. „Vindicta. Kampf für Freiheit von Verfolgung“ (1865), 4. „Formatrix. Anthropologische Studien über urnische Liebe“ (1865), 5. „Ara spei. Moralphilosophische und socialphilosophische Studien über urnische Liebe“ (1865), 6. „Gladius furens. Das Naturräthsel der Urningsliebe und der Irrthum als Gesetzgeber“ (1868), 7. „Memnon. Die Geschlechtsnatur des mannliebenden Urnings“(1868), 8. „Incubus. Urningsliebe und Blutgier“ (1869), 9. „Argonauticus. Zastrow und die Urninge des pietistischen, ultramontanen und freidenkenden Lagers“ (1869), 10. „Prometheus. Beiträge zur Erforschung des Naturräthsels des Uranismus und zur Erörterung der sittlichen und gesellschaftlichen Interessen des Urningsthums“ (1870), 11. „Araxes. Ruf nach Befreiung der Urningsnatur vom Strafgesetz“ (1870) und 12. „Critische Pfeile. Denkschrift über die Bestrafung der Urningsliebe“ (1879); ein Nachdruck der Originalausgaben in vier Bänden, herausgegeben von Hubert Kennedy unter maßgeblicher Mitarbeit von Wolfram Setz, erschien 1994. Weitere Schriften: „Der Urning und sein Recht“ (nicht vollendet, 1879/80), „Auf Bienchens Flügeln. Ein Flug um den Erdball in Epigrammen und poetischen Bildern“ (1875, Neuausgabe 2017) und „Matrosengeschichten und Gedichte“ (Lesebuch, hg. v. Wolfram Setz, 1998).
Karl-Heinrich-U.-Platz an der Weißadlergasse in der Innenstadt. Die Platzbenennung am 17.5.2015, dem „Internationalen Tag gegen Homophobie“, wurde von einer Ausstellung des Freien Deutschen Hochstifts unter dem Titel „Ausschluss eines Schwulen – Karl Heinrich Ulrichs und das Freie Deutsche Hochstift“ im Arkadensaal des Goethehauses begleitet.
Nach dem Schulbesuch in Aurich, Detmold und Celle studierte U. von 1844 bis 1847 Jura an den Universitäten in Göttingen und Berlin. Anschließend war er sechs Jahre lang im Justiz- und Verwaltungsdienst des Königreichs Hannover tätig, zu dem damals sein ostfriesischer Geburtsort gehörte. Nachdem er Ende 1854 seinen Dienst als „Hülfsrichter“ in Hildesheim quittieren musste, um ein drohendes Disziplinarverfahren wegen „widernatürlicher Wollust“ abzuwenden, lebte U. als freier Autor und Journalist u. a. in Burgdorf bei Hannover, Ffm., Würzburg und Stuttgart, schließlich in Italien. In Ffm. wohnte er von Oktober 1859 bis März 1863, zunächst in der Schäfergasse 38, dann in der (Großen) Friedberger Straße 30 und schließlich im Reuterweg 10. Bereits Anfang 1860 trat er dem „Freien Deutschen Hochstift für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung“ bei, das wenige Monate zuvor als freie Akademie gegründet worden war. Nach eigenem Bekunden war das Hochstift „damals ein Sammelbecken für die vielfältigen Interessen selbstbewusster, liberal gesinnter Bürger“. U. war in Ffm. als Sekretär des Bundestagsgesandten Justin von Linde tätig und verfasste regelmäßig Berichte für die in Augsburg erscheinende Allgemeine Zeitung. Daneben beschäftigte er sich in verschiedenen Studien mit Fragen der Literatur, Mythologie und des öffentlichen Rechts.
Noch bevor das Wort „Homosexualität“ 1869 erfunden wurde, wurde U. zu einem frühen Vertreter der seinerzeit im Entstehen begriffenen Sexualwissenschaft und zu einem Vorläufer der erst Jahrzehnte nach seinem Tod erstarkenden emanzipatorischen Bürgerrechtsbewegung von Menschen, die heute meist unter dem Kürzel LSBTIQ zusammengefasst werden. Volkmar Sigusch prägte vor diesem Hintergrund die Bezeichnung „der erste Schwule der Weltgeschichte“ auf ihn. Vier Bekenntnisbriefe, die U. 1862 in Ffm. an seine Verwandten schrieb, wurden 1899 von dem Berliner Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1935) im „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ veröffentlicht. Schon in diesen Briefen sprach U. von einem „dritten Geschlecht“. Bahnbrechend waren U.’ zwölf Monographien über das „Räthsel der mannmännlichen Liebe“, die er von 1864 bis 1879 herausgab. Die ersten fünf Schriften in dieser Reihe veröffentlichte er unter dem Motto „Vincula frango“ (Ich zerbreche die Ketten) und mit Rücksicht auf seine Verwandten unter dem Pseudonym „Numa Numantius“; ab 1868 verbreitete er die Schriften unter seinem Klarnamen. U. war der erste, der eine moderne Theorie der „Homosexualität“ vorlegte und den „Homosexuellen“ als natürliches und gesundes Sexualsubjekt beschrieb. Später, im Zuge der Ausdifferenzierung seiner Theorie, unterschied er zwischen sieben größeren oder 13 kleineren Geschlechtern [unter ihnen Mannlinge, Weiblinge, Uranodioninge („Bisexuelle“), Zwittermänner und Zwitterweiber]. Er nahm für die Entwicklungsgeschichte des Menschen einen „embryonalen Urzwitter“ an, in dem vier „geschlechtliche Keime“ angelegt seien, drei körperliche und ein seelischer, und im Falle von „homosexuellen“ Männern sprach er von der „anima muliebris virili corpore inclusa“, einer in den männlichen Körper eingeschlossenen weiblichen Seele. Bei seinen Wortschöpfungen stützte sich U. auf Platons „Symposion“. Er nannte einen Mann, der Männer liebt, zunächst „Uranier“, später „Urning“ (nach der älteren Aphrodite oder „Venus Urania“, der mutterlosen Tochter des Himmelsgottes Uranos, die „nicht teilhat am Weiblichen“). Eine Frau, die eine Frau liebt, war für ihn eine „Uranierin“, „Urningin“ oder „Urnin“. Für U. war der „urnische“ Eros „von himmlischer Art und von höchstem Wert für den Staat wie für den Einzelnen, denn den Liebenden wie auch den Geliebten zwingt er dazu, mit allen Kräften nach der Tugend zu streben“. U. trat öffentlich für die Straffreiheit gleichgeschlechtlicher Beziehungen ein, forderte das Recht auf Ehe zwischen Menschen des gleichen Geschlechts und war der Überzeugung, dass, wenn die Wissenschaft erst einmal das Angeborensein der „urnischen“ Liebe anerkannt habe, der Kampf für die Menschenrechte gleichgeschlechtlich liebender Männer (und Frauen) gewonnen sei. Durch Zeitungsinserate, Leserbriefe und Eingaben stellte U. sich auch schützend vor „homosexuelle“ Angeklagte und Verurteilte seiner Zeit wie beispielsweise den Ffter Politiker und Dramatiker Johann Baptist von Schweitzer. U.’ Schriften erreichten seinerzeit interessierte Leser an so weit entfernten Orten wie St. Petersburg und St. Louis, so dass er schließlich mit „einer weitzerstreuten Schaar“ männerliebender Männer im Austausch stand.
Als Mitglied des Freien Deutschen Hochstifts in Ffm. zeigte sich U. als umtriebig und keinesfalls monothematisch orientiert, vor allem in den Anfangsjahren seiner Mitgliedschaft. In den Mitgliederakten sind 41 Einzelstücke erhalten, die U. betreffen. Die meisten stammen aus den Jahren 1860 und 1861. In den Vorschlägen, Anträgen und Eingaben, die U. dem Hochstift unterbreitete, geht es etwa um Fragen der Nahrungsmittelversorgung für die Bevölkerung, physikalische Probleme wie das „Aufsteigen des Wassers in nicht geschlossenem Raume“, das Verhältnis des deutschen zum böhmischen Volk, die deutsche Sprache, die „geistige Einheit“ aller Deutschen, die Unrechtmäßigkeit der Todesstrafe und den Erfinder der Schiffsschraube.
Gleichwohl wurde U. 1864 schon nach wenigen Jahren aus dem Hochstift ausgeschlossen, weil man sich durch ihn provoziert fühlte. Der Schriftführer der Akademie teilte U. am 5.4.1864 mit, er sei „wegen der gegen ihn obschwebenden criminellen Verfolgung“ nicht mehr als Mitglied zu betrachten. Wenige Monate zuvor war U. wegen des „Versuchs der widernatürlichen Unzucht“ steckbrieflich gesucht worden; der Steckbrief („Vorführungsbefehl“), allerdings auf den falschen Namen „Carl Anton Ulrichs“ ausgestellt, war am 19. und 21.11.1863 im „Amtsblatt der freien Stadt Fft.“ veröffentlicht worden. U. antwortete erst ein Jahr später auf den Ausschluss aus dem Hochstift, nachdem er die ersten fünf Monographien seiner „Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe“ in Druck gegeben hatte. Selbstbewusst brachte er vor: „Eine Ausschließung, welche erfolgt, ohne den auszuschließenden zuvor gehört zu haben, verstößt gegen die Fundamente alles positiven u(nd) moralischen Rechts.“ Daher erachtete er den Beschluss des Hochstifts als „null u(nd) nichtig“. Er verlangte, gehört zu werden, und zwar zum Inhalt der mitgesandten fünf Hefte seiner Forschungen. Das Hochstift aber wies U.’ Argumentation zurück und bekräftigte den Ausschluss. Da U. in seinen Schriften behauptet habe, es gebe neben den beiden bekannten Geschlechtern „noch eine besondere, denselben nicht angehörige Art von menschlichen Wesen, welche er Urninge nennt“, und er sich selbst zu dieser Menschengruppe zähle, die Satzung des Freien Deutschen Hochstifts aber zu einer „Mitgliedschaft dieser Wesen keine Erwähnung“ tue, könne er nicht Mitglied der Akademie bleiben. Im Übrigen wolle man sich „mit diesem, das Gefühl verletzenden Gegenstande“ nicht weiter befassen und verwahrte sich gegen weitere Zuschriften. Dennoch antwortete U. am 3.5.1865 gewandt und beherzt auf die neuerliche Abweisung. Er unterstrich, die Natur schaffe nicht zwei, sondern vier Geschlechter (gemeint waren der „Urning“ und die „Urnin“ neben den „normalgeschlechtlichen“ Männern und Frauen). Er sehe zwar ein, dass der Gegenstand das Gefühl verletze, doch wenn das Hochstift deswegen „mit dem Ausdruck der Verachtung zur Tagesordnung“ übergehen wolle, scheine ihm die Akademie „hinfort wohl eine anerkennenswerthe Anstalt für Gefühl u(nd) d(er)gl(eichen) zu sein“. Es dürfe aber fraglich sein, ob sie dann noch verdiene, den „hohen Namen ‚Hochstift für Wissenschaften‘ zu führen“, oder ob sie nicht das Wort „Wissenschaften“ aus ihrem Namen streichen müsse. Zudem, so U., sei es „engherzig“ und „ungerecht“, einen „Urning“ auszuschließen: „Es wäre das eine Intoleranz, horrender wahrlich, als sie in den finstersten Zeiten des Glaubenshasses gegen Ketzer u(nd) Juden je geübt worden ist! Darf man seinen Augen trauen? Ist das der Geist des 19ten Jahrhunderts? (…) Ist das des freien Deutschen Hochstifts würdig?“ Solche „Engherzigkeit“ müsste in letzter Konsequenz auch dazu führen, einen Platen, Winckelmann oder Alexander von Humboldt auszuschließen. U. deutete in seinem Brief ferner an, es gebe ein angesehenes Mitglied des Hochstifts, das ebenfalls „Urning“ sei, sich aber öffentlich noch nicht als solcher zu erkennen gegeben habe. Er erklärte sich gegebenenfalls bereit, dieses Mitglied beim Namen zu nennen. Das Hochstift ließ sich allerdings auch von dieser Androhung nicht beeindrucken. U.’ Mitgliedsakte wurde geschlossen, und jemand verzeichnete auf dem Aktendeckel den Warnhinweis „Urning“.
Nach seinem Wegzug aus Ffm. 1863 wurde U. zweimal verhaftet und schließlich aus Hannover ausgewiesen, nachdem er die Annexion seines Vaterlandes durch Preußen (1866) nicht hinnehmen wollte. Um diese Zeit wurde er in einer tumultartigen Szene von Kollegen niedergeschrien, als er sich auf dem Sechsten Deutschen Juristentag in München gegen die Strafbarkeit der männlichen „Homosexualität“ aussprach. Über die Ereignisse schrieb U. später: „Bis an meinen Tod werde ich es mir zum Ruhme anrechnen, daß ich am 29. August 1867 zu München in mir den Muth fand, Aug’ in Auge entgegenzutreten einer tausendjährigen, vieltausendköpfigen, wuthblickenden Hydra, welche mich und meine Naturgenossen wahrlich nur zu lange schon mit Gift und Geifer bespritzt hat, viele zum Selbstmord trieb, ihr Lebensglück allen vergiftete. Ja, ich bin stolz, daß ich die Kraft fand, der Hydra der öffentlichen Verachtung einen ersten Lanzenstoß in die Weichen zu versetzen.“
U. lebte bis 1870 in Würzburg, anschließend in Stuttgart. Nachdem Preußen im Zuge der Reichsgründung den „Schandparagraphen“ (§ 175 RStGB, der gleichgeschlechtliche Akte unter Männern mit Strafe belegte) auch vormals liberalen deutschen Ländern aufgezwungen hatte, verließ U. entmutigt und enttäuscht 1880 den deutschen Sprachraum und ging ins italienische Exil. Er ließ sich zunächst in Neapel nieder und zog von dort drei Jahre später nach Aquila (nordöstlich von Rom), wo er als Sprachlehrer seinen Lebensabend unter finanziell prekären Verhältnissen verbrachte.
U. war vielseitig gebildet und interessiert. Er verfasste preisgekrönte rechtswissenschaftliche Abhandlungen wie „Pax Westphalica quid constituerit de principum jure reformando religionisque exercitio subditorum“ (Der Westfälische Friede und seine Bestimmungen zur Reform des Rechts der Herrschenden und der Religionsausübung der Untertanen; ungedruckt) und „Fori reconventionis origines et doctrina“ (Ursprünge und Lehre von der gesetzlichen Behandlung der Wiedererlangung, 1846). Er beschäftigte sich u. a. mit dem Postmonopol von Thurn und Taxis, widmete eine Gedenkschrift dem bayerischen König Ludwig II. (1845-1886) und schrieb lateinische Studentenlieder, Matrosengeschichten und Gedichte. Von 1889 bis 1895 gab er die Zeitschrift „Alaudae“ („Die Lerchen“) in lateinischer Sprache heraus.
Bereits 1866 hatte U. die Zeitschrift „Uranus“ konzipiert. Auch wenn sie 1870 nur mit einem Heft erschien (in Form der Schrift „Prometheus“ in der Reihe „Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe“), kommt „Uranus“ eine besondere Bedeutung zu. Das geplante Periodikum mit dem Untertitel „Beiträge zur Erforschung des Naturräthsels des Uranismus und zur Erörterung der sittlichen und gesellschaftlichen Interessen des Urningsthums“ kann als erste „Homosexuellenzeitschrift“ der Welt angesehen werden. Sie sollte laut U. ein „Verfechter von Menschenwürde und Menschenrecht“ sein und „Urningen“ Orientierung und Halt bieten. Als Herausgeber und Autor ging U. unter Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Zuschriften von Lesern auf die Bibel ein, auf das Traumleben, aber auch auf Fälle von Erpressung. 1873 bekannte er: „Die Zeitschrift ‚Uranus‘ ist leider nicht ins Leben getreten: aus Mangel an Abonnenten.“ Realisiert wurde die Idee eines Periodikums für „Homosexuelle“ erst ein Vierteljahrhundert später, durch Adolf Brands Zeitschrift „Der Eigene“ (ab 1896) und Magnus Hirschfelds „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ (ab 1899). Hirschfeld war es auch, der drei Jahre nach dem Tod von U. dessen Schriften (mit einzelnen textlichen Änderungen) erstmals erneut herausgab.
Die zwölf Schriften in der Reihe „Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe“ sind: 1. „Vindex. Social-juristische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe“ (1864), 2. „Inclusa. Anthropologische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe“ (1864), 3. „Vindicta. Kampf für Freiheit von Verfolgung“ (1865), 4. „Formatrix. Anthropologische Studien über urnische Liebe“ (1865), 5. „Ara spei. Moralphilosophische und socialphilosophische Studien über urnische Liebe“ (1865), 6. „Gladius furens. Das Naturräthsel der Urningsliebe und der Irrthum als Gesetzgeber“ (1868), 7. „Memnon. Die Geschlechtsnatur des mannliebenden Urnings“(1868), 8. „Incubus. Urningsliebe und Blutgier“ (1869), 9. „Argonauticus. Zastrow und die Urninge des pietistischen, ultramontanen und freidenkenden Lagers“ (1869), 10. „Prometheus. Beiträge zur Erforschung des Naturräthsels des Uranismus und zur Erörterung der sittlichen und gesellschaftlichen Interessen des Urningsthums“ (1870), 11. „Araxes. Ruf nach Befreiung der Urningsnatur vom Strafgesetz“ (1870) und 12. „Critische Pfeile. Denkschrift über die Bestrafung der Urningsliebe“ (1879); ein Nachdruck der Originalausgaben in vier Bänden, herausgegeben von Hubert Kennedy unter maßgeblicher Mitarbeit von Wolfram Setz, erschien 1994. Weitere Schriften: „Der Urning und sein Recht“ (nicht vollendet, 1879/80), „Auf Bienchens Flügeln. Ein Flug um den Erdball in Epigrammen und poetischen Bildern“ (1875, Neuausgabe 2017) und „Matrosengeschichten und Gedichte“ (Lesebuch, hg. v. Wolfram Setz, 1998).
Karl-Heinrich-U.-Platz an der Weißadlergasse in der Innenstadt. Die Platzbenennung am 17.5.2015, dem „Internationalen Tag gegen Homophobie“, wurde von einer Ausstellung des Freien Deutschen Hochstifts unter dem Titel „Ausschluss eines Schwulen – Karl Heinrich Ulrichs und das Freie Deutsche Hochstift“ im Arkadensaal des Goethehauses begleitet.
Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Raimund Wolfert.
Lexika: Aldrich, Robert/Wotherspoon, Garry (Hg.): Who’s Who in Gay & Lesbian History. From Antiquity to World War II. London/New York 2001.Aldrich/Wotherspoon (Hg.): Who’s Who in Gay & Lesbian History 2001, S. 451f. | Hergemöller, Bernd-Ulrich (Hg.): Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum. Neubearb. u. erg. Ausgabe. 2 Bde. Berlin/Münster 2010.Hergemöller (Hg.): Mann für Mann 2010, Bd. 2, S. 1188-1190. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Volkmar Sigusch in: NDB 26 (2017), S. 615f. | Sigusch, Volkmar/Grau, Günter (Hg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Ffm./New York 2009.Sigusch/Grau (Hg.): Personenlex. d. Sexualforschung 2009, S. 706-715.
Literatur: Beachy, Robert M.: Das andere Berlin. Die Erfindung der Homosexualität. Eine deutsche Geschichte 1867-1933. Aus dem Engl. von Hans Freundl u. Thomas Pfeiffer. München 2015.Beachy: Das andere Berlin 2015, S. 25-78. | Berger, Frank/Setzepfandt, Christian: 102 neue Unorte in Fft. Ffm. 2012.Berger/Setzepfandt: 102 Unorte 2012, S. 202f. | Capri. Zeitschrift für schwule Geschichte. [Hg. v. dem Verein „Freunde eines Schwulen-Museums in Berlin e. V.“ (bis 1996), dann v. Schwulen-Museum Berlin.] 53 Hefte. Berlin u. a. 1987-2019.Herzer, Manfred: Ein Brief von Kertbeny in Hannover an Ulrichs in Würzburg. In: Capri 1987, H. 1, S. 26-35. | Capri. Zeitschrift für schwule Geschichte. [Hg. v. dem Verein „Freunde eines Schwulen-Museums in Berlin e. V.“ (bis 1996), dann v. Schwulen-Museum Berlin.] 53 Hefte. Berlin u. a. 1987-2019.Sulzenbacher, Hannes: „Man bekommt aber den Eindruck, als ob Ulrichs nicht recht normal wäre.“ Acht Petitionen gegen den österreichischen Unzuchts-Paragraphen. In: Capri 1994, H. 17, S. 21-29. | Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität hg. v. Magnus Hirschfeld. [Nebentitel: Jahrbuch für homosexuelle Forschungen.] Jg. 1-9, 13-14, 19-23. Leipzig, später Stuttgart 1899-1908, 1913-14, 1919-23. Zwischenzeitlich fortgesetzt u. d. T.: Vierteljahrsberichte des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees [während der Kriegszeit]. Nr. 1-12, 15-18. Leipzig 1909-12, 1915-18.Hirschfeld, Magnus (Hg.): Vier Briefe von Karl Heinrich Ulrichs (Numa Numantius) an seine Verwandten [1862]. In: Jb. f. sexuelle Zwischenstufen 1 (1899), S. 36-70. | Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität hg. v. Magnus Hirschfeld. [Nebentitel: Jahrbuch für homosexuelle Forschungen.] Jg. 1-9, 13-14, 19-23. Leipzig, später Stuttgart 1899-1908, 1913-14, 1919-23. Zwischenzeitlich fortgesetzt u. d. T.: Vierteljahrsberichte des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees [während der Kriegszeit]. Nr. 1-12, 15-18. Leipzig 1909-12, 1915-18.Hirschfeld, Magnus: Drei deutsche Gräber in fernem Land. In: Jb. f. sexuelle Zwischenstufen 10 (1909) = Vierteljahresberichte des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 1 (1909), H. 1, S. 31-35. | Kennedy, Hubert: Karl Heinrich Ulrichs. Sein Leben und sein Werk. Stuttgart 1990. 2., überarbeitete Aufl. u. d. T.: Karl Heinrich Ulrichs. Leben und Werk. Hamburg 2001. (Bibliothek rosa Winkel 27).Kennedy: Karl Heinrich Ulrichs 1990, 2. Aufl. 2001. | Lautmann, Rüdiger/Taeger, Angela (Hg.): Männerliebe im alten Deutschland. Sozialgeschichtliche Abhandlungen. Berlin 1992.Kennedy, Hubert: Karl Heinrich Ulrichs formuliert eine Theorie, und das Freie Deutsche Hochstift wendet sie auf ihn an. In: Lautmann/Taeger (Hg.): Männerliebe im alten Deutschland 1992, S. 39-59. | Leck, Ralph Matthew: Vita Sexualis. Karl Ulrichs and the Origins of Sexual Science. Urbana/Chicago/Springfield 2016.Leck: Vita Sexualis. Karl Ulrichs and the Origins of Sexual Science 2016. | Mildenberger, Florian (Hg.): Die andere Fakultät. Theorie, Geschichte, Gesellschaft. Hamburg 2015.Sigusch, Volkmar: „Das Eis ist gebrochen“. Karl Heinrich Ulrichs als Vorkämpfer der Homosexuellen. In: Mildenberger (Hg.): Die andere Fakultät 2015, S. 99-121. | Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. Bisher 64 Hefte. Berlin 1983-2020.Herzer, Manfred: Karl Heinrich Ulrichs und die Idee des WhK. Zu einem unbekannten Ulrichs-Text. In: Mitt. d. Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, H. 10 (1987), S. 34-38. | Setz, Wolfram (Hg.): Neue Funde und Studien zu Karl Heinrich Ulrichs. Hamburg 2004. (Bibliothek rosa Winkel 36).Setz (Hg.): Neue Funde u. Studien zu Karl Heinrich Ulrichs 2004. | Setz, Wolfram: Die Geschichte der Homosexualitäten und die schwule Identität an der Jahrtausendwende. Eine Vortragsreihe aus Anlaß des 175. Geburtstags von Karl Heinrich Ulrichs. Berlin 2000. (Bibliothek rosa Winkel 25).Setz: Die Geschichte der Homosexualitäten u. die schwule Identität an der Jahrtausendwende 2000. | Setz, Wolfram: Karl Heinrich Ulrichs zu Ehren. Materialien zu Leben und Werk. Berlin 2000.Setz: Karl Heinrich Ulrichs zu Ehren 2000. | Sigusch, Volkmar: Der erste Schwule der Weltgeschichte. Berlin 2000. (Bibliothek rosa Winkel 21).Sigusch: Der erste Schwule der Weltgeschichte 2000. | Ulrichs, Karl Heinrich: Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe. Nachdruck der Originalausgaben. Hg. v. Hubert Kennedy. 4 Bde. Berlin 1994. (Bibliothek rosa Winkel 7-10).Ulrichs: Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe 1994.
Quellen: New York Times. New York City 1851-heute.Stack, Liam: Overlooked No More: Karl Heinrich Ulrichs, Pioneering Gay Activist. In: New York Times, 1.7.2020 (https://www.nytimes.com/2020/07/01/obituaries/karl-heinrich-ulrichs-overlooked.html, abgerufen am 17.9.2020).
Internet: Ostfriesische Landschaft, Regionalverband für Kultur, Wissenschaft und Bildung, Aurich. https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/BLO/Ulrichs.pdf
Hinweis: Artikel über Karl Heinrich Ulrichs von Hubert Kennedy.Ostfriesische Landschaft, 17.9.2020. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Heinrich_UlrichsWikipedia, 17.9.2020.
GND: 11888980X (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).
© 2025 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den
Autoren
Empfohlene Zitierweise:
Wolfert, Raimund: Ulrichs, Karl Heinrich. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/9186
Stand des Artikels: 30.9.2020
Erstmals erschienen in Monatslieferung: 10.2020.

