George, Heinrich
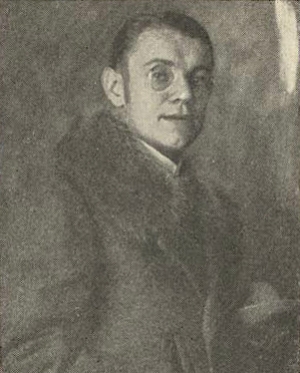
Heinrich George
Fotografie von Hugo Erfurth (aus dem Ffter Theater-Almanach 1919/20, S. 75).
Fotografie von Hugo Erfurth (aus dem Ffter Theater-Almanach 1919/20, S. 75).
© entfällt. Diese Abbildung ist gemeinfrei.
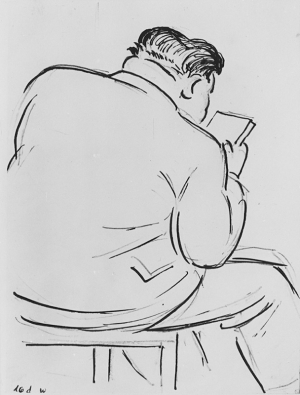
Heinrich George beim Rollenstudium
Zeichnung von Lino Salini.
© Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 5011).
George, Heinrich. Eigentl. (bis zur amtlichen Namensänderung durch Verfügung des Preußischen Justizministers vom 12.10.1932): Georg August Friedrich Hermann Schulz. Schauspieler. Theaterintendant. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 9.10.1893 Stettin, † 25.9.1946 Speziallager Sachsenhausen, begraben (seit der Umbettung aus dem Oranienburger Wald bei Sachsenhausen 1994) in Berlin-Zehlendorf.
Aus Dresden, wo G. nach ersten Engagements (ab 1912) in Kolberg, Bromberg und Neustrelitz und dreijährigem Kriegsdienst (1914-17) zum Ensemble des Albert-Theaters (1917/18) gehörte, wurde er bereits 1917 von Karl Zeiß, dem bisherigen Generaldirektor des Dresdner Schauspielhauses und kommenden Generalintendanten der Ffter Städtischen Bühnen, zur Spielzeit 1918/19 nach Ffm. verpflichtet. Von 1918 bis 1921 war G. am Ffter Schauspielhaus unter Zeiß und dessen Nachfolger Weichert fest engagiert. Er bezeichnete diese Zeit später als eine der wichtigsten Stationen seiner Laufbahn: „Wenn Stettin meine Vaterstadt ist, so ist Ffm. meine Mutterstadt. Sie ist die Geburtsstätte der Kunst in mir, sie hat mein Kunstgefühl wachsen lassen, meinen Kunstverstand geschärft.“ (Ffter Theateralmanach 1933/34, [S. 60].) G. prägte hier, zusammen mit seiner Bühnenpartnerin Gerda Müller, den Stil des „Ffter Expressionismus“ auf dem Theater wesentlich mit. Er entwickelte sich in seiner Ffter Zeit zum außergewöhnlichen, ebenso kraftstrotzenden wie feinfühligen Charakterdarsteller, u. a. als Baron in Gorkis „Nachtasyl“ (24.9.1918), in der Titelrolle von Wedekinds „Marquis von Keith“ (5.11.1918), als Christian Maske in Sternheims „1913“ (23.1.1919), als Teiresias in Hasenclevers „Antigone“ (20.2.1919), als Jean in Strindbergs „Fräulein Julie“ (19.4.1919), als Angelo in Shakespeares „Maß für Maß“ (23.12.1919), als Holofernes in Hebbels „Judith“ (30.4.1920), als Christlieb Schleich in der Uraufführung von Unruhs „Platz“ (Regie: Gustav Hartung, 3.6.1920) und in der Titelrolle von Kokoschkas „Orpheus“ (2.2.1921). In Ffm. übernahm G. auch seine erste Regiearbeit, die Inszenierung der beiden Stücke „Mörder, Hoffnung der Frauen“ und „Hiob“ von Oskar Kokoschka für eine Sonntagsmatinee des Neuen Theaters am 11.4.1920, die wegen des Einsatzes einer Prostituierten als Eros im „Hiob“ für einen – nach der Erinnerung von Carl Zuckmayer in einer Prügelei auf offener Szene endenden – Theaterskandal sorgte. Nicht nur auf der Bühne war es wegen G.s rauschhaften Lebens und Spielens in Ffm. zu Konflikten gekommen. Er feierte wüste Feste, trank bis zum Umfallen, warf das Geld zum Fenster hinaus und häufte einen solchen Schuldenberg an, dass seine Gage gepfändet werden musste; das Ensemble entschied sogar seinen Ausschluss, weil er durch seinen exzessiven Lebensstil den Theaterbetrieb gefährdete. Bereits seit dem Sommer 1920 durch lukrative Gastspielverträge (u. a. als Mammon in Hofmannsthals „Jedermann“ unter Regie von Max Reinhardt bei den Salzburger Festspielen und am Großen Schauspielhaus Berlin, Aug./Sept. 1920) verführt, wechselte G. noch vor dem eigentlichen Ablauf seines Ffter Vertrags (31.7.1923) nach einer Zwischenstation am Wiener Burgtheater 1922 endgültig nach Berlin.
Zu einem der bedeutendsten Schauspieler in Theater und Film aufgestiegen (u. a. als Wächter der Herzmaschine in „Metropolis“, 1927, als Zola in „Dreyfus“, 1930, und als Franz Biberkopf in „Berlin Alexanderplatz“, 1931), kam der Star zu Gastspielen mehrfach nach Ffm. zurück: 1926/27 an das Neue Theater, u. a. in der Titelrolle von Hauptmanns „Fuhrmann Henschel“ (14.-26.5.1927), am 5.2.1927 an das Schauspielhaus in der Titelrolle von Unruhs „Bonaparte“ (UA), 1932-34 bei den Römerbergfestspielen, 1932-34 und 1936/37 an das Schauspielhaus, u. a. als Napoleon in dem als Staatsakt aufgeführten Drama „Die Hundert Tage“ von Benito Mussolini und Giovacchino Forzano (22.10.1933), sowie 1937 und 1942 zu Lesungen. Legendär wurde sein Auftreten als Gottfried von Berlichingen im „Urgötz“ in der ersten Inszenierung der im Goethejahr 1932 begründeten Römerbergfestspiele. Von der rechten Presse wurde G., der dem Schauspieler und NSDAP-Anhänger Gerhard Ritter gerade in der „Reichs-Goethe-Woche“ im August 1932 in der Rolle des Götz auf dem Römerberg vorgezogen worden war, damals noch als „begeisterter Republikaner“ und „Sympathisant der Kommunisten“ bezeichnet und deshalb geschmäht.
Bald nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten arrangierte sich G. im Interesse der Fortsetzung seiner Karriere jedoch weitgehend mit dem neuen politischen System, wirkte in nationalsozialistischen Propagandafilmen mit („Hitlerjunge Quex“, 1933, „Jud Süß“, 1940, und „Kolberg“, 1945) und wurde 1937 zum Staatsschauspieler und Intendanten des Schiller-Theaters in Berlin ernannt. An der 1938 eröffneten Bühne konnte er einige vom NS-Regime bedrohte Mitarbeiter schützen, u. a. den ihm befreundeten Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger (1890-1964), den er bei den Vorbereitungen zu der Matinee für Kokoschka in Ffm. 1920 kennengelernt hatte und den er nun als Dramaturgen im Künstlerischen Beirat des Schiller-Theaters beschäftigte. Als prominenter Repräsentant des NS-Regimes in Theater und Film angesehen, wurde G. nach Kriegsende 1945 von sowjetischer Seite mehrfach verhaftet und blieb ab Juni 1945 interniert, zuletzt im Speziallager Sachsenhausen. Dort starb er, nach mehr als 15-monatiger Haft entkräftet, an den Folgen einer Blinddarmoperation.
Porträtiert u. a. von Otto Dix (in der Rolle als Terje Wiggen in dem Film „Das Meer ruft“ nach Ibsen, 1932; im Besitz des Kunstmuseums Stuttgart) und von Max Beckmann („Familienbild G.“, 1935; als Dauerleihgabe des Landes Berlin in der Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Berlin).
Verheiratet (seit 1933) mit der Schauspielerin Berta Drews (1901-1987). Aus der Verbindung stammten zwei Söhne, der Fotograf und Werbefilmer Jan Albert Götz G. (* 1931) und der Schauspieler Götz Karl August G. (1938-2016). Mit der Rolle seines Vaters setzte sich Götz G., einer der größten deutschen Film- und Fernsehstars der Nachkriegszeit, u. a. in dem Dokudrama „George“ (Fernsehspiel, Regie: Joachim A. Lang, 2013) auseinander.
Briefmarke der Deutschen Bundespost zu G.s 100. Geburtstag (1993).
Zu einem der bedeutendsten Schauspieler in Theater und Film aufgestiegen (u. a. als Wächter der Herzmaschine in „Metropolis“, 1927, als Zola in „Dreyfus“, 1930, und als Franz Biberkopf in „Berlin Alexanderplatz“, 1931), kam der Star zu Gastspielen mehrfach nach Ffm. zurück: 1926/27 an das Neue Theater, u. a. in der Titelrolle von Hauptmanns „Fuhrmann Henschel“ (14.-26.5.1927), am 5.2.1927 an das Schauspielhaus in der Titelrolle von Unruhs „Bonaparte“ (UA), 1932-34 bei den Römerbergfestspielen, 1932-34 und 1936/37 an das Schauspielhaus, u. a. als Napoleon in dem als Staatsakt aufgeführten Drama „Die Hundert Tage“ von Benito Mussolini und Giovacchino Forzano (22.10.1933), sowie 1937 und 1942 zu Lesungen. Legendär wurde sein Auftreten als Gottfried von Berlichingen im „Urgötz“ in der ersten Inszenierung der im Goethejahr 1932 begründeten Römerbergfestspiele. Von der rechten Presse wurde G., der dem Schauspieler und NSDAP-Anhänger Gerhard Ritter gerade in der „Reichs-Goethe-Woche“ im August 1932 in der Rolle des Götz auf dem Römerberg vorgezogen worden war, damals noch als „begeisterter Republikaner“ und „Sympathisant der Kommunisten“ bezeichnet und deshalb geschmäht.
Bald nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten arrangierte sich G. im Interesse der Fortsetzung seiner Karriere jedoch weitgehend mit dem neuen politischen System, wirkte in nationalsozialistischen Propagandafilmen mit („Hitlerjunge Quex“, 1933, „Jud Süß“, 1940, und „Kolberg“, 1945) und wurde 1937 zum Staatsschauspieler und Intendanten des Schiller-Theaters in Berlin ernannt. An der 1938 eröffneten Bühne konnte er einige vom NS-Regime bedrohte Mitarbeiter schützen, u. a. den ihm befreundeten Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger (1890-1964), den er bei den Vorbereitungen zu der Matinee für Kokoschka in Ffm. 1920 kennengelernt hatte und den er nun als Dramaturgen im Künstlerischen Beirat des Schiller-Theaters beschäftigte. Als prominenter Repräsentant des NS-Regimes in Theater und Film angesehen, wurde G. nach Kriegsende 1945 von sowjetischer Seite mehrfach verhaftet und blieb ab Juni 1945 interniert, zuletzt im Speziallager Sachsenhausen. Dort starb er, nach mehr als 15-monatiger Haft entkräftet, an den Folgen einer Blinddarmoperation.
Porträtiert u. a. von Otto Dix (in der Rolle als Terje Wiggen in dem Film „Das Meer ruft“ nach Ibsen, 1932; im Besitz des Kunstmuseums Stuttgart) und von Max Beckmann („Familienbild G.“, 1935; als Dauerleihgabe des Landes Berlin in der Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Berlin).
Verheiratet (seit 1933) mit der Schauspielerin Berta Drews (1901-1987). Aus der Verbindung stammten zwei Söhne, der Fotograf und Werbefilmer Jan Albert Götz G. (* 1931) und der Schauspieler Götz Karl August G. (1938-2016). Mit der Rolle seines Vaters setzte sich Götz G., einer der größten deutschen Film- und Fernsehstars der Nachkriegszeit, u. a. in dem Dokudrama „George“ (Fernsehspiel, Regie: Joachim A. Lang, 2013) auseinander.
Briefmarke der Deutschen Bundespost zu G.s 100. Geburtstag (1993).
Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sabine Hock.
Artikel in: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 245f., verfasst von: Sabine Hock.
Lexika: Kosch, Wilhelm: Deutsches Theaterlexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Fortgef. v. Ingrid Bigler-Marschall. 7 Bde. Klagenfurt, ab 4 (1998) Bern/München, ab 5 (2004) Zürich, ab 7 (2012) Berlin 1953-2012. Bisher 6 Nachtragsbände (bis Sr). Berlin 2013-18.Kosch: Theater 1 (1953), S. 540. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Klaus Riemer in: NDB 6 (1964), S. 234f. | Weniger, Kay: Das große Personenlexikon des Films. Die Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Produzenten, Komponisten, Drehbuchautoren, Filmarchitekten, Ausstatter, Kostümbildner, Cutter, Tontechniker, Maskenbildner und Special Effects Designer des 20. Jahrhunderts. 8 Bde. Berlin 2001.Weniger: Personenlex. d. Films 3, S. 227-229.
Literatur: Beyer, Friedemann: Die Gesichter der Ufa. Starportraits einer Epoche. 2. verbesserte Aufl. München 1992. (Heyne Filmbibliothek 175).Beyer: Gesichter der Ufa 1992, S. 190-193. | Deutsches Bühnen-Jahrbuch. Theatergeschichtliches Jahr- und Adressbuch. [Untertitel ab 1977: Das große Adressbuch für Bühne, Film, Funk und Fernsehen.] Hg. v. d. Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger. Bisher Jg. 26-129. Berlin, später Hamburg 1915-2021.Nachruf in: Dt. Bühnen-Jb. 1951, S. 76. | Ffter Theater-Almanach. Ffm. [1832]/1843-1951 (mit Erscheinungslücken).Ffter Theater-Almanach 1920/21, S. 93f. | Ffter Theater-Almanach. Ffm. [1832]/1843-1951 (mit Erscheinungslücken).Grußwort von Heinrich George in: Ffter Theater-Almanach 1933/34, [S. 60]. | Heidenreich, Bernd/Neitzel, Sönke (Hg.): Medien im Nationalsozialismus. Paderborn 2010.Fricke, Kurt: Heinrich George. In: Heidenreich/Neitzel (Hg.): Medien im Nationalsozialismus 2010, S. 83-107. | Heym, Heinrich (Hg.): Fft. und sein Theater. Im Auftrage der Städtischen Bühnen hg. (...). Ffm. 1963. Bibliotheksausgabe mit Nachwort und Register. Ffm. 1971.Heym (Hg.): Theater 1963, S. 26, 33f., 37-39, 43, 54, 250. | Hildenbrandt, Fred: ...ich soll dich grüssen von Berlin. 1922-1932. Berliner Erinnerungen ganz und gar unpolitisch. Post mortem hg. v. zwei Freunden. München 1966.Hildenbrandt: Erinnerungen 1966, S. 104-108. | Körner, Torsten: Götz George. Mit dem Leben gespielt. Biographie. Ffm. 2008.Körner: Götz George 2008, bes. S. 9-61. | Laregh, Peter: Heinrich George. Komödiant seiner Zeit. München 1992.Laregh: Heinrich George 1992. | Maser, Werner: Heinrich George. Mensch aus Erde gemacht. Die politische Biographie. Berlin 1998.Maser: Heinrich George 1998. | Mohr, Albert Richard (Hg.): Die Römerberg-Festspiele Ffm. 1932-1939. Ein Beitrag zur Theatergeschichte in Bildern und zeitgenössischen Berichten. Ffm. [1968].Mohr: Römerberg-Fsp. 1968, S. 22. | Mohr, Albert Richard: Das Ffter Schauspiel 1929-1944. Eine Dokumentation zur Theatergeschichte mit zeitgenössischen Berichten und Bildern. Ffm. [Copyright 1974].Mohr: Schausp. 1974, S. 61-64, 90f., 97, 153, 180. | Riess, Curt: Das gab’s nur einmal. Das Buch der schönsten Filme unseres Lebens. 2., erw. Aufl. Hamburg 1957.Riess: Das gab’s nur einmal 1957, S. 263f. | Schültke, Bettina: Theater oder Propaganda? Die Städtischen Bühnen Ffm. 1933-1945. Ffm. 1997. (Studien zur Ffter Geschichte 40).Schültke: Städt. Bühnen 1997, S. 19, 23f., 246-249, 373, 391, 467 (Anm. 17), 503f. (Anm. 49). | Siedhoff, Thomas: Das Neue Theater in Ffm. 1911-1935. Versuch der systematischen Würdigung eines Theaterbetriebs. Ffm. 1985. (Studien zur Ffter Geschichte 19).Siedhoff: Neues Theater 1985, S. 19, 49, 57-59, 70, 83, 102 u. 105 sowie Nr. 357-358, 627-628 u. 653. | Zuckmayer, Carl: Als wär’s ein Stück von mir. Horen der Freundschaft. Ffm. 1966.Zuckmayer: Als wär’s ein Stück von mir 1966, S. 267f., 299-301; Ausgabe von 1986, S. 261f., 293f. | Zuckmayer, Carl: Geheimreport. Hg. v. Gunther Nickel und Johanna Schrön. Göttingen 2002. (Zuckmayer-Schriften, im Auftr. d. Carl-Zuckmayer-Gesellschaft hg. v. Gunther Nickel, Erwin Rotermund und Hans Wagener).Zuckmayer: Geheimreport 2002, S. 16, 95f., 226f., 299-301, 337f., 393, 467, 476.
Quellen: ISG, Personalakten der Stadtverwaltung (Best. A.11.02), ab ca. 1900.ISG, PA 9.781-9.784. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/3.524.
Internet: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_GeorgeWikipedia, 6.7.2016.
GND: 118690507 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).
© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den
Autoren
Empfohlene Zitierweise:
Hock, Sabine: George, Heinrich. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2366
Stand des Artikels: 24.7.2021
Erstmals erschienen in Monatslieferung: 07.2016.

