Urspruch, Anton
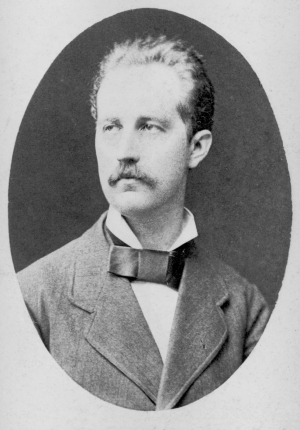
Anton Urspruch
Fotografie von Straub & Kühn (aus der Sammlung Manskopf im Besitz der UB Ffm.).
© Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Ffm. (Sign. S 36/F02021).
Urspruch, Peter Anton. Prof. Komponist. Pianist. Musikpädagoge. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 17.2.1850 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 11.1.1907 Ffm.
U. entstammte einer künstlerisch veranlagten Familie. Sein Großvater väterlicherseits, Philipp Jacob U. (1770-1841), war Schauspieler, die Großmutter Helene Antonie U., geb. Zuccarini (1775-1833), eine recht berühmte Sängerin, beide zuletzt am Ffter Komödienhaus. Der Vater Carl Theodor U. (1810-1891), der, als achtes Kind seiner Eltern geboren, den damaligen Ffter Großherzog Carl Theodor von Dalberg zum Taufpaten erhalten hatte, war Literat und Zeitungsredakteur in seiner Heimatstadt Ffm. Die aus Obernbreit/Unterfranken gebürtige Mutter Anna Elisabeth U., geb. Sänger (1812-1889), kam aus einer jüdischen Vorsängerfamilie und trat durch die Taufe 1844 in Ffm. zum christlichen Glauben über.
U. besuchte das städtische Gymnasium in Ffm. und zeigte früh Begabung für Musik und Malerei. Seine Musikausbildung übernahmen Martin Wallenstein (Klavier), Ignaz Lachner und schließlich Joachim Raff (Komposition). Um seine pianistische Ausbildung abzurunden, ging U. 1871 nach Weimar zu Franz Liszt, der ihn gerne als Schüler nahm und in der Zeit seines Aufenthalts täglich mit ihm musizierte. Die ihn musikalisch prägenden mehrmonatigen Sommerbesuche in Weimar bei Liszt setzte er bis 1875 fort.
Ab 1872 trat U. als Konzertpianist auf. Daneben schrieb er Klavier- und Liedkompositionen, später auch größer besetzte Werke. Als op. 1 hatte er 1871 die vierhändige „Sonate quasi Fantasia“ vollendet, die später bei Kistner im Druck erschien. In den Jahren bis 1878 entstanden u. a. die Fantasiestücke für Klavier op. 2, die Lieder op. 3 und 4, die Liebeslieder op. 6 und das Klavierkonzert op. 9.
U. strebte eine Lehrtätigkeit in fester Anstellung an. Bevor er eine entsprechende Position 1877/78 am neu gegründeten Hoch’schen Konservatorium in Ffm. erhielt, konnte er in Weimar noch Richard Wagner bei den Vorproben für die Eröffnung des Festspielhauses in Bayreuth erleben. Der Leiter des 1878 eröffneten Hoch’schen Konservatoriums, U.s früherer Lehrer Joachim Raff, berief ihn als Klavier- und Kompositionsdozenten nach Ffm. Er war somit Kollege von Clara Schumann. 1881 heiratete U. Maria Emilie, gen. Emmy, Cranz (1858-?), die Tochter des Hamburger Musikverlegers Alwin Cranz (1834-1923). Aus der Ehe stammten vier Töchter.
Die seiner späteren Frau noch während der Brautzeit gewidmete Symphonie in Es-Dur op. 14 war im Konzertsaal (u. a. beim „Museum“ in Ffm., 1886) recht erfolgreich. So fand U. mehr und mehr Anerkennung als Komponist. Als 1882 Raff starb und viele Lehrer mit seinem Nachfolger Bernhard Scholz unzufrieden waren, wurde ein neues Konservatorium gegründet, das viele der Dozenten des Hoch’schen Konservatoriums aufnahm. Auch U. wechselte als Professor für Komposition und Kontrapunkt 1883 dorthin und unterrichtete am Raff-Konservatorium bis zu seinem Lebensende.
Er schrieb weiterhin Klavier- und Kammermusikwerke sowie auch Werke für Solo-Gesang und für Chor. Es folgten eine Oper „Der Sturm“ nach Shakespeare (UA: Ffm., 1888), die nur mäßig erfolgreich war, und später die komische Oper „Das Unmöglichste von Allem“ nach Lope de Vega (UA: Karlsruhe, 1897; Ffter EA 1899), die mit großem Erfolg in verschiedenen Metropolen Europas aufgeführt wurde. In den letzten Lebensjahren widmete U. sich daneben dem gregorianischen Choral in Theorie und Praxis. Sein letztes, unvollendetes Werk war die Oper „Die heilige Cäcilie“, die erst 2021 zu Ende instrumentiert und uraufgeführt wurde. Im Jahr 1906 litt U. mehrfach unter Herzproblemen, die im Januar 1907 zu seinem Tod führten.
Aufgewachsen mit Werken der Klassik und Frühromantik, die auch sein pianistisches Repertoire bildeten, pflegte U. einen gemäßigt modernen Kompositionsstil und rückte damit in die Nähe von Johannes Brahms. Bei der Komposition der lyrischen Werke entwickelte er sich zu einem angesehenen Vertreter der Spätromantik mit ausdrucksvoller Melodik und einfallsreicher Instrumentierung. Im Bereich Kirchenmusik setzte sich U. für die Wiederbelebung des gregorianischen Chorals ein, dem er auch eine Reihe von Untersuchungen widmete, u. a. „Der Gregorianische Choral und die Choralfrage“ (1901).
Mitglied der Loge zum Ffter Adler.
Grab auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann F 1569). Das marmorne Grabmal (Entwurf: Ludwig Sand, 1908) mit einem Porträtmedaillon des Verstorbenen zeigt zudem die heilige Cäcilie in einem Relief nach der Skulptur von Stefano Maderno in der Kirche Santa Cecilia in Trastevere in Rom.
Den musikalischen Nachlass von U. übergab seine jüngste Tochter Theodora Kircher-U. (1896-1979) im Jahr 1966 der Stadt- und Universitätsbibliothek (heute: UB) in Ffm.
Erst seit den 1990er Jahren findet das Werk des bis dahin weitgehend vergessenen Komponisten wieder zunehmend Beachtung. Bei einem Konzert anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt Ffm. 1994 führte die Museums-Gesellschaft erstmals wieder ein Werk von U., dessen Cello-Sonate op. 29, auf. Anlässlich von U.s 150. Geburtstag 2000 veranstalteten die Stadt Ffm. (Presse- und Informationsamt und Institut für Stadtgeschichte), der Hessische Rundfunk und der Verein „Freunde Fft.s“ das Gedächtniskonzert „Berühmt. Vergessen! Neu entdeckt?“ mit Kammermusik, Chorwerken und Liedern des Komponisten. Zum 100. Todestag von U. 2007 fand eine Reihe von Konzerten statt, u. a. in Ffm. ein Liederabend des Freien Deutschen Hochstifts in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Goethehaus und ein Kammerkonzert der Ffter Bürgerstiftung im Holzhausenschlösschen. Seit 2009 fördert die auf Initiative der Enkelin Veronica Kircher (1929-2021) gegründete und seit 2010 ins Vereinsregister eingetragene Anton-U.-Gesellschaft mit Sitz in Münster/Westfalen die Forschung zu Leben und Schaffen von U. sowie die Wiederentdeckung und Neuaufführung seiner Werke.
U. besuchte das städtische Gymnasium in Ffm. und zeigte früh Begabung für Musik und Malerei. Seine Musikausbildung übernahmen Martin Wallenstein (Klavier), Ignaz Lachner und schließlich Joachim Raff (Komposition). Um seine pianistische Ausbildung abzurunden, ging U. 1871 nach Weimar zu Franz Liszt, der ihn gerne als Schüler nahm und in der Zeit seines Aufenthalts täglich mit ihm musizierte. Die ihn musikalisch prägenden mehrmonatigen Sommerbesuche in Weimar bei Liszt setzte er bis 1875 fort.
Ab 1872 trat U. als Konzertpianist auf. Daneben schrieb er Klavier- und Liedkompositionen, später auch größer besetzte Werke. Als op. 1 hatte er 1871 die vierhändige „Sonate quasi Fantasia“ vollendet, die später bei Kistner im Druck erschien. In den Jahren bis 1878 entstanden u. a. die Fantasiestücke für Klavier op. 2, die Lieder op. 3 und 4, die Liebeslieder op. 6 und das Klavierkonzert op. 9.
U. strebte eine Lehrtätigkeit in fester Anstellung an. Bevor er eine entsprechende Position 1877/78 am neu gegründeten Hoch’schen Konservatorium in Ffm. erhielt, konnte er in Weimar noch Richard Wagner bei den Vorproben für die Eröffnung des Festspielhauses in Bayreuth erleben. Der Leiter des 1878 eröffneten Hoch’schen Konservatoriums, U.s früherer Lehrer Joachim Raff, berief ihn als Klavier- und Kompositionsdozenten nach Ffm. Er war somit Kollege von Clara Schumann. 1881 heiratete U. Maria Emilie, gen. Emmy, Cranz (1858-?), die Tochter des Hamburger Musikverlegers Alwin Cranz (1834-1923). Aus der Ehe stammten vier Töchter.
Die seiner späteren Frau noch während der Brautzeit gewidmete Symphonie in Es-Dur op. 14 war im Konzertsaal (u. a. beim „Museum“ in Ffm., 1886) recht erfolgreich. So fand U. mehr und mehr Anerkennung als Komponist. Als 1882 Raff starb und viele Lehrer mit seinem Nachfolger Bernhard Scholz unzufrieden waren, wurde ein neues Konservatorium gegründet, das viele der Dozenten des Hoch’schen Konservatoriums aufnahm. Auch U. wechselte als Professor für Komposition und Kontrapunkt 1883 dorthin und unterrichtete am Raff-Konservatorium bis zu seinem Lebensende.
Er schrieb weiterhin Klavier- und Kammermusikwerke sowie auch Werke für Solo-Gesang und für Chor. Es folgten eine Oper „Der Sturm“ nach Shakespeare (UA: Ffm., 1888), die nur mäßig erfolgreich war, und später die komische Oper „Das Unmöglichste von Allem“ nach Lope de Vega (UA: Karlsruhe, 1897; Ffter EA 1899), die mit großem Erfolg in verschiedenen Metropolen Europas aufgeführt wurde. In den letzten Lebensjahren widmete U. sich daneben dem gregorianischen Choral in Theorie und Praxis. Sein letztes, unvollendetes Werk war die Oper „Die heilige Cäcilie“, die erst 2021 zu Ende instrumentiert und uraufgeführt wurde. Im Jahr 1906 litt U. mehrfach unter Herzproblemen, die im Januar 1907 zu seinem Tod führten.
Aufgewachsen mit Werken der Klassik und Frühromantik, die auch sein pianistisches Repertoire bildeten, pflegte U. einen gemäßigt modernen Kompositionsstil und rückte damit in die Nähe von Johannes Brahms. Bei der Komposition der lyrischen Werke entwickelte er sich zu einem angesehenen Vertreter der Spätromantik mit ausdrucksvoller Melodik und einfallsreicher Instrumentierung. Im Bereich Kirchenmusik setzte sich U. für die Wiederbelebung des gregorianischen Chorals ein, dem er auch eine Reihe von Untersuchungen widmete, u. a. „Der Gregorianische Choral und die Choralfrage“ (1901).
Mitglied der Loge zum Ffter Adler.
Grab auf dem Ffter Hauptfriedhof (Gewann F 1569). Das marmorne Grabmal (Entwurf: Ludwig Sand, 1908) mit einem Porträtmedaillon des Verstorbenen zeigt zudem die heilige Cäcilie in einem Relief nach der Skulptur von Stefano Maderno in der Kirche Santa Cecilia in Trastevere in Rom.
Den musikalischen Nachlass von U. übergab seine jüngste Tochter Theodora Kircher-U. (1896-1979) im Jahr 1966 der Stadt- und Universitätsbibliothek (heute: UB) in Ffm.
Erst seit den 1990er Jahren findet das Werk des bis dahin weitgehend vergessenen Komponisten wieder zunehmend Beachtung. Bei einem Konzert anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt Ffm. 1994 führte die Museums-Gesellschaft erstmals wieder ein Werk von U., dessen Cello-Sonate op. 29, auf. Anlässlich von U.s 150. Geburtstag 2000 veranstalteten die Stadt Ffm. (Presse- und Informationsamt und Institut für Stadtgeschichte), der Hessische Rundfunk und der Verein „Freunde Fft.s“ das Gedächtniskonzert „Berühmt. Vergessen! Neu entdeckt?“ mit Kammermusik, Chorwerken und Liedern des Komponisten. Zum 100. Todestag von U. 2007 fand eine Reihe von Konzerten statt, u. a. in Ffm. ein Liederabend des Freien Deutschen Hochstifts in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Goethehaus und ein Kammerkonzert der Ffter Bürgerstiftung im Holzhausenschlösschen. Seit 2009 fördert die auf Initiative der Enkelin Veronica Kircher (1929-2021) gegründete und seit 2010 ins Vereinsregister eingetragene Anton-U.-Gesellschaft mit Sitz in Münster/Westfalen die Forschung zu Leben und Schaffen von U. sowie die Wiederentdeckung und Neuaufführung seiner Werke.
Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Ann Kersting-Meuleman.
Artikel in: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 496, verfasst von: Reinhard Frost.
Lexika: Erche, Bettina: Der Ffter Hauptfriedhof. Hg. v. Ffter Denkmalforum, den Freunden Fft.s [u.] der Müller-Klein-Rogge-Stiftung. Supplementband zur Denkmaltopographie Stadt Ffm. Hg. v. Denkmalamt der Stadt Ffm. in Zusammenarb. m. d. Landesamt für Denkmalpflege in Hessen. Ffm. [Copyright 1999]. (Beiträge zum Denkmalschutz in Ffm., Bd. 11; / Teil der Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland).Denkmaltop. Hauptfriedhof, S. 55f., 294. | Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Unter Mitarb. zahlreicher Musikforscher (...) hg. v. Friedrich Blume. 17 Bde. Kassel/Basel 1949-86. Neuausgabe (2., völlig überarb. Aufl.): Hg. v. Ludwig Finscher. 10 Bde. (Sachteil), 18 Bde. (Personenteil) und ein Supplementband. Kassel/Stuttgart 1994-2008. Erschlossen, fortgesetzt, aktualisiert und erweitert als Online-Datenbank: MGG Online (unter: www.mgg-online.com). Kassel u. a. ab 2016.SL/Alfons Ott in: MGG, 2. Aufl., Personenteil 16 (2006), Sp. 1231f. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 610.
Literatur: Ffter Musik- und Theater-Zeitung. Zeitschrift für moderne Kunst-Pflege. 3 Jahrgänge. Ffm. 1906-08.Nachruf von Carl Süss in: Ffter Musik- u. Theater-Zeitung 2 (1907), Nr. 3 (18.1.1907), S. 1f. | Kircher-Urspruch, Theodora: Gedenkschrift zum 125. Geburtstag Anton Urspruch. Lebens- und Werkskizze eines Komponisten um die Jahrhundertwende. [Typoskript. Zürich um 1975.]Kircher-Urspruch: Gedenkschrift zum 125. Geburtstag Anton Urspruch 1975.
Quellen: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbücher, Ffm., 1533-1848 bzw. 1849-1939.Heiratseintrag der Eltern Carl Theodor Urspruch und Anna Elisabeth Sänger, 14.4.1846: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Heiratsbuch 33 (1846-48), S. 44, Nr. 57. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Tauf- bzw. Geburtsbücher, Ffm., 1533-1850 bzw. 1851-1909.Geburts- und Taufeintrag des Vaters Carl Theodor Urspruch, geb. am 30.4.1810 in Ffm.: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Tauf-/Geburtsbuch 52 (1809-10), S. 732. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebücher (Beerdigungs- bzw. Sterbebücher), Ffm., 1565-1850 bzw. 1851-1989.Sterbeeintrag der Großmutter Helene Antonie Urspruch, geb. Zuccarini, gestorben am 1.10.1833 in Ffm.: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebuch 63 (1833), S. 525, Nr. 956. | ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebücher (Beerdigungs- bzw. Sterbebücher), Ffm., 1565-1850 bzw. 1851-1989.Sterbeeintrag des Großvaters Philipp Jacob Urspruch, gestorben am 25.12.1841 in Ffm.: ISG, Kirchen- bzw. Standesbücher: Toten-/Sterbebuch 71 (1841), S. 681, Nr. 1184. | ISG, Einwohnermeldekartei („Nullkartei“; Best. A.12.02), ca. 1870-1930.ISG, Nullkartei. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/2.427.
Internet: Anton Urspruch, Internetseiten zu Leben und Werk, Hg.: Anton-Urspruch-Gesellschaft, Münster. http://www.antonurspruch.de - http://www.antonurspruch.de/werke.htm -
Hinweis: Mit einem Verzeichnis der Werke von Anton Urspruch.Anton-Urspruch-Gesellschaft, 7.12.2021. | Das Kulturportal der Stadt Ffm., Bereich Musik, Komponistinnen und Komponisten in Ffm., hg. vom Kulturamt der Stadt Ffm. https://kultur-frankfurt.de/portal/de/Musik/Urspruch2cAnton1850-1907/2434/0/71915/mod1981-seite2-details1/5.aspxKomponistinnen u. Komponisten in Ffm., 7.12.2021. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_UrspruchWikipedia, 7.12.2021.
GND: 117315699 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).
© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den
Autoren
Empfohlene Zitierweise:
Kersting-Meuleman, Ann: Urspruch, Anton. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/1534
Stand des Artikels: 15.12.2021
Erstmals erschienen in Monatslieferung: 12.2021.

