Heerdt, Johann Christian
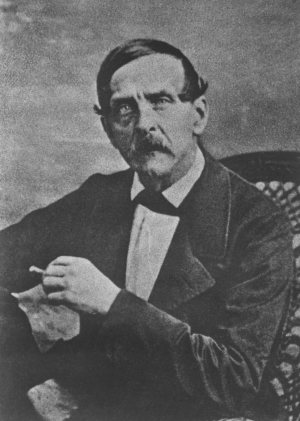
Johann Christian Heerdt
Fotografie (aus Kaulen: Freud’ und Leid im Leben deutscher Künstler 1878).
Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte, Ffm. (Sign. S7P Nr. 6089).
© entfällt. Diese Abbildung ist gemeinfrei.
Heerdt, Johann Christian. Landschaftsmaler. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 4.5.1812 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 1.6.1878 (Ffm.-)Bockenheim.
Sechstes Kind des Ffter Bürgers und Handelsmanns Clemens H. (1778-1828) und dessen Ehefrau Anna Maria, geb. Götz (1780-1855). Zehn Geschwister, von denen die folgenden drei Schwestern und drei Brüder das Erwachsenenalter erreichten: Susanna Sibylla H. (1806-1894), verheiratet (seit 1831) mit dem Unternehmer und Politiker Clemens Reifert (auch: Reiffert; 1807-1878), der eine Fabrik für Kutschen und Eisenbahnwaggons in (Ffm.-)Bockenheim betrieb; Elise H. (1808-1881), verheiratet (seit 1831) mit dem Maler und Kupferstecher Friedrich Wilhelm Delkeskamp (1794-1872); Johann Friedrich H. (1810-1845), Handelsmann und Lehrer der kaufmännischen Wissenschaften; Maria Wilhelmine, gen. Minna, H. (1813-1896), verheiratet (von 1855 bis zur Scheidung 1867) mit dem Lehrer Heinrich Ludwig Scholl (1820-?) aus Bonames; Johann Georg H. (1819-?), Kaufmann, der das Eisenwarengeschäft der Eltern in der Friedberger Gasse (heute: Große Friedberger Straße) weiterführte; Gottfried Carlot H. (1821-1867), Sattlermeister. Verheiratet (seit 1845) mit Maria Dorothea Amalie, gen. Malchen, H., geb. Binding (1807-?), einer Tochter des Bäckermeisters Johann Lorenz Binding (1776-1856) aus der Fahrgasse. Der Bierbrauer Conrad Binding (1846-1933) war ihr Neffe, der Jurist Karl Binding (1841-1920) ihr Neffe zweiten Grades und der Schriftsteller Rudolf G. Binding (1867-1938) ihr Großneffe zweiten Grades. Drei Töchter: Auguste H. (1846-1917), verheiratet (seit 1869) mit dem promovierten Chemiker Georg Philipp Anton Kühner (1839-1884), der eine Maschinenölfabrik in Ffm. betrieb; Susanna Clementine H. (1848-1937), verheiratet (seit 1870) mit dem Deckenfabrikanten Georg Ludwig Victor Zöppritz (1839-1922) in (Heidenheim-)Mergelstetten an der Brenz; Margarethe Friederike Emma H. (1849-1936), Malerin, unverheiratet.
H. wuchs in einer nicht sehr wohlhabenden, aber gebildeten und kunstsinnigen Familie auf. Sein Vater hatte naturwissenschaftliche Interessen, musizierte, zeichnete und erwarb auf Auktionen Kunstwerke. H. besuchte die Musterschule. Der spätere Landschaftsmaler Carl Morgenstern, mit dem H. eine lebenslange Freundschaft verband, war sein Klassenkamerad. Erste künstlerische Anregungen erhielt H. schon in früher Jugend von dem Maler Anton Radl, der mit seiner Frau Rosina Margaretha, geb. Hochschlitz (1770-1844), im Obergeschoss des H.’schen Hauses in der Friedberger Gasse (heute: Große Friedberger Straße) zur Miete wohnte. Das kinderlose Paar wurde von H. und seinen Geschwistern oft besucht. Nach Beendigung der Musterschule wechselte H. auf die Zeichenschule von Heinrich Friedrich Höffler (1793-1844). Als er im Städelschen Kunstinstitut wiederholt Aquarellkopien der großen Meister für seinen Lehrherrn anfertigen musste, wurde sein Talent von dem Maler und Grafiker Karl Friedrich Wendelstadt, dem als Inspektor die Beaufsichtigung der kopierenden Maler und Malerinnen vor Ort oblag, entdeckt. Wendelstadt ermöglichte ihm wohl ab 1829 den kostenlosen Unterricht am Städelschen Kunstinstitut. H. durchlief alle angebotenen Klassen am Städel; zu seinen Lehrern gehörten Johann Nepomuk Zwerger, Friedrich Maximilian Hessemer und insbesondere Philipp Veit.
Nachdem H. 1833 sein Studium am Städelschen Kunstinstitut beendet und anschließend noch bis 1834 praktisch in dessen Malerschule gearbeitet hatte, nahm er auf Empfehlung von Veit eine Stelle als Privatlehrer bei der Fürstin von Isenburg-Birstein an. Nach einem Jahr Unterrichtstätigkeit hatte er ausreichend Geld gespart, um an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863) Landschaftsmalerei zu studieren, ein Fach, das seinerzeit in Ffm. nicht angeboten wurde. Mit den Malern Alfred Rethel und Andreas Achenbach (1815-1910) machte er zu Studienzwecken Ausflüge an die Nahe und die Mosel. Bereits 1836 verließ H. nach einem politischen Konflikt zwischen altpreußischen und rheinischen Studenten die Düsseldorfer Akademie. Zu den 30 Künstlern, die sich damals von der Düsseldorfer Akademie abwandten, gehörte auch sein Freund, der Landschaftsmaler Heinrich Funk (1807-1877), bei dem sich H. zwei Jahre lang in Ffm. weiter ausbildete und mit dem er ein Malatelier eröffnete. Als Funk später eine Stellung an der Kunstschule in Stuttgart annahm, arbeitete H. alleine als selbstständiger Maler in Ffm. weiter. H. „schwärmte für großartige und einsame Gebirgswelten“ (so die Tochter Emma H. in ihren Erinnerungen) und ging daher häufig zu Studienzwecken auf Reisen. Seine Motive fand er u. a. in den Alpen, im Allgäu, an den oberitalienischen Seen, aber auch in seiner näheren Umgebung, am Rhein und in dessen Seitentälern sowie im Taunus, insbesondere in Kronberg.
Die Familiengründung 1845 erlebte H. als Hemmnis in seiner künstlerischen Entfaltung. Da er allein durch den Verkauf von Bildern seine Familie nicht unterhalten konnte, sah er sich gezwungen, durch Malunterricht bei Privatleuten und an Schulen zusätzlich Geld zu verdienen. Malen konnte er nur noch am Wochenende und in den Schulferien, in denen er gelegentlich Studienreisen nach Tirol, in die Schweiz und das bayrische Gebirge unternahm. Die Familie wohnte zunächst von 1845 bis etwa 1851 in Ffm., zog dann nach Bockenheim und kehrte um 1854 zurück nach Ffm., um den Töchtern einen angemessenen Schulbesuch zu ermöglichen. Für eine Zeitlang lebte H. mit der Familie in Kronberg und pendelte zweimal pro Woche zu Fuß nach Ffm., um seiner Unterrichtstätigkeit nachgehen zu können. Später wohnte das Ehepaar H. auf dem Kies 2 in Bockenheim. Im familiären Umkreis pflegte H. verstärkt seine zweite Begabung, die Musikalität. Er sang, spielte Flöte und Gitarre und gehörte längere Zeit einem Streichquartett an. Die Familie H. veranstaltete häufig musikalische Treffen und Hauskonzerte, bei denen in unterschiedlichen Formationen mit Freunden und Freundinnen auf hohem Niveau musiziert wurde. Zu den regelmäßigen Gästen gehörte eine Zeitlang der Bildhauer Johann Nepomuk Zwerger nebst Frau und Kindern. Die Tochter Emma Zwerger (1832-1905), eine Klavierlehrerin, unterrichtete später H.s heranwachsende Töchter. Auch Freundinnen von H.s Töchtern, darunter Sophie Morgenstern (seit 1872 verh. Zwerger, 1846-1882), die Tochter des Malerfreunds Carl Morgenstern und spätere Schwiegertochter des Lehrers Johann Nepomuk Zwerger, gehörten zu den musizierenden Gästen. Weitere gute Freunde, mit denen H. regen Umgang pflegte, waren die Maler Karl Ballenberger, Ferdinand Klimsch, Georg Hom (1838-1911), Carl Engel (von der Rabenau) und Florian Margraff (1830-1885) sowie der Musiker Wilhelm Hill, von dem H. auch ein Porträt anfertigte.
Durch ein Schreiben an die Administration des Städelschen Kunstinstituts veranlasste H. 1869, dass seine Tochter Emma H. dort als Schülerin aufgenommen wurde und in einem Damenatelier studieren durfte. Ab 1870, als seine beiden ältesten Töchter verheiratet waren, konnte H. dank des nachlassenden ökonomischen Drucks das Unterrichten aufgeben, um sich wieder ganz der Malerei zu widmen. Doch litt er schon damals an Heiserkeit; später entwickelte sich ein Kehlkopfkrebs, der ihm zuletzt lange das Sprechen versagte.
H. malte „anhand von Studien im Atelier komponierte Ideal-Landschaften“ und folgte damit „dem traditionellen spätromantischen Themenrepertoire“ [Carsten Roth in: AKL 71 (2011), S. 40], wobei sich seine Gemälde durch altmeisterliche Technik und Detailreichtum auszeichnen. Eine besondere Vorliebe hatte er auch für die Darstellung malerischer Architekturen. Zwar zeigte H. seine Werke regelmäßig in den Jahresausstellungen des Ffter Kunstvereins, dennoch war er in seiner Heimatstadt „weit weniger bekannt (…), als er es verdient“ hätte (FZ, Nr. 156, 5.6.1878, Morgenblatt, Beilage, S. 1). Zudem beteiligte er sich an den Allgemeinen deutschen Kunst-Ausstellungen (1858 in München, 1861 in Köln, 1868 in Wien), verkaufte 1863 eine Ansicht von Kronberg im Taunus (mit Staffage von Carl Engel, 1862) an die Württembergische Staatsgalerie in Stuttgart und nahm 1873 mit zwei Landschaftsbildern an der Weltausstellung in Wien teil.
Außer im Kunsthandel und in Privatbesitz befinden sich Werke von H. im Kunstpalast in Düsseldorf und im Museum Wiesbaden sowie in Ffm. im Historischen Museum („Kronberg im Taunus mit Falkenstein“, Ölgemälde, 1852, u. a.) und im Städel Museum.
H. und seine Frau wurden auf dem Alten Friedhof in Bockenheim begraben.
1879 fand eine Gedenkausstellung mit Werken (Zeichnungen, Studien und Kartons) von H. und einem von der Tochter Emma H. gemalten Ölporträt des Künstlers im Städelschen Kunstinstitut statt.
H. wuchs in einer nicht sehr wohlhabenden, aber gebildeten und kunstsinnigen Familie auf. Sein Vater hatte naturwissenschaftliche Interessen, musizierte, zeichnete und erwarb auf Auktionen Kunstwerke. H. besuchte die Musterschule. Der spätere Landschaftsmaler Carl Morgenstern, mit dem H. eine lebenslange Freundschaft verband, war sein Klassenkamerad. Erste künstlerische Anregungen erhielt H. schon in früher Jugend von dem Maler Anton Radl, der mit seiner Frau Rosina Margaretha, geb. Hochschlitz (1770-1844), im Obergeschoss des H.’schen Hauses in der Friedberger Gasse (heute: Große Friedberger Straße) zur Miete wohnte. Das kinderlose Paar wurde von H. und seinen Geschwistern oft besucht. Nach Beendigung der Musterschule wechselte H. auf die Zeichenschule von Heinrich Friedrich Höffler (1793-1844). Als er im Städelschen Kunstinstitut wiederholt Aquarellkopien der großen Meister für seinen Lehrherrn anfertigen musste, wurde sein Talent von dem Maler und Grafiker Karl Friedrich Wendelstadt, dem als Inspektor die Beaufsichtigung der kopierenden Maler und Malerinnen vor Ort oblag, entdeckt. Wendelstadt ermöglichte ihm wohl ab 1829 den kostenlosen Unterricht am Städelschen Kunstinstitut. H. durchlief alle angebotenen Klassen am Städel; zu seinen Lehrern gehörten Johann Nepomuk Zwerger, Friedrich Maximilian Hessemer und insbesondere Philipp Veit.
Nachdem H. 1833 sein Studium am Städelschen Kunstinstitut beendet und anschließend noch bis 1834 praktisch in dessen Malerschule gearbeitet hatte, nahm er auf Empfehlung von Veit eine Stelle als Privatlehrer bei der Fürstin von Isenburg-Birstein an. Nach einem Jahr Unterrichtstätigkeit hatte er ausreichend Geld gespart, um an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863) Landschaftsmalerei zu studieren, ein Fach, das seinerzeit in Ffm. nicht angeboten wurde. Mit den Malern Alfred Rethel und Andreas Achenbach (1815-1910) machte er zu Studienzwecken Ausflüge an die Nahe und die Mosel. Bereits 1836 verließ H. nach einem politischen Konflikt zwischen altpreußischen und rheinischen Studenten die Düsseldorfer Akademie. Zu den 30 Künstlern, die sich damals von der Düsseldorfer Akademie abwandten, gehörte auch sein Freund, der Landschaftsmaler Heinrich Funk (1807-1877), bei dem sich H. zwei Jahre lang in Ffm. weiter ausbildete und mit dem er ein Malatelier eröffnete. Als Funk später eine Stellung an der Kunstschule in Stuttgart annahm, arbeitete H. alleine als selbstständiger Maler in Ffm. weiter. H. „schwärmte für großartige und einsame Gebirgswelten“ (so die Tochter Emma H. in ihren Erinnerungen) und ging daher häufig zu Studienzwecken auf Reisen. Seine Motive fand er u. a. in den Alpen, im Allgäu, an den oberitalienischen Seen, aber auch in seiner näheren Umgebung, am Rhein und in dessen Seitentälern sowie im Taunus, insbesondere in Kronberg.
Die Familiengründung 1845 erlebte H. als Hemmnis in seiner künstlerischen Entfaltung. Da er allein durch den Verkauf von Bildern seine Familie nicht unterhalten konnte, sah er sich gezwungen, durch Malunterricht bei Privatleuten und an Schulen zusätzlich Geld zu verdienen. Malen konnte er nur noch am Wochenende und in den Schulferien, in denen er gelegentlich Studienreisen nach Tirol, in die Schweiz und das bayrische Gebirge unternahm. Die Familie wohnte zunächst von 1845 bis etwa 1851 in Ffm., zog dann nach Bockenheim und kehrte um 1854 zurück nach Ffm., um den Töchtern einen angemessenen Schulbesuch zu ermöglichen. Für eine Zeitlang lebte H. mit der Familie in Kronberg und pendelte zweimal pro Woche zu Fuß nach Ffm., um seiner Unterrichtstätigkeit nachgehen zu können. Später wohnte das Ehepaar H. auf dem Kies 2 in Bockenheim. Im familiären Umkreis pflegte H. verstärkt seine zweite Begabung, die Musikalität. Er sang, spielte Flöte und Gitarre und gehörte längere Zeit einem Streichquartett an. Die Familie H. veranstaltete häufig musikalische Treffen und Hauskonzerte, bei denen in unterschiedlichen Formationen mit Freunden und Freundinnen auf hohem Niveau musiziert wurde. Zu den regelmäßigen Gästen gehörte eine Zeitlang der Bildhauer Johann Nepomuk Zwerger nebst Frau und Kindern. Die Tochter Emma Zwerger (1832-1905), eine Klavierlehrerin, unterrichtete später H.s heranwachsende Töchter. Auch Freundinnen von H.s Töchtern, darunter Sophie Morgenstern (seit 1872 verh. Zwerger, 1846-1882), die Tochter des Malerfreunds Carl Morgenstern und spätere Schwiegertochter des Lehrers Johann Nepomuk Zwerger, gehörten zu den musizierenden Gästen. Weitere gute Freunde, mit denen H. regen Umgang pflegte, waren die Maler Karl Ballenberger, Ferdinand Klimsch, Georg Hom (1838-1911), Carl Engel (von der Rabenau) und Florian Margraff (1830-1885) sowie der Musiker Wilhelm Hill, von dem H. auch ein Porträt anfertigte.
Durch ein Schreiben an die Administration des Städelschen Kunstinstituts veranlasste H. 1869, dass seine Tochter Emma H. dort als Schülerin aufgenommen wurde und in einem Damenatelier studieren durfte. Ab 1870, als seine beiden ältesten Töchter verheiratet waren, konnte H. dank des nachlassenden ökonomischen Drucks das Unterrichten aufgeben, um sich wieder ganz der Malerei zu widmen. Doch litt er schon damals an Heiserkeit; später entwickelte sich ein Kehlkopfkrebs, der ihm zuletzt lange das Sprechen versagte.
H. malte „anhand von Studien im Atelier komponierte Ideal-Landschaften“ und folgte damit „dem traditionellen spätromantischen Themenrepertoire“ [Carsten Roth in: AKL 71 (2011), S. 40], wobei sich seine Gemälde durch altmeisterliche Technik und Detailreichtum auszeichnen. Eine besondere Vorliebe hatte er auch für die Darstellung malerischer Architekturen. Zwar zeigte H. seine Werke regelmäßig in den Jahresausstellungen des Ffter Kunstvereins, dennoch war er in seiner Heimatstadt „weit weniger bekannt (…), als er es verdient“ hätte (FZ, Nr. 156, 5.6.1878, Morgenblatt, Beilage, S. 1). Zudem beteiligte er sich an den Allgemeinen deutschen Kunst-Ausstellungen (1858 in München, 1861 in Köln, 1868 in Wien), verkaufte 1863 eine Ansicht von Kronberg im Taunus (mit Staffage von Carl Engel, 1862) an die Württembergische Staatsgalerie in Stuttgart und nahm 1873 mit zwei Landschaftsbildern an der Weltausstellung in Wien teil.
Außer im Kunsthandel und in Privatbesitz befinden sich Werke von H. im Kunstpalast in Düsseldorf und im Museum Wiesbaden sowie in Ffm. im Historischen Museum („Kronberg im Taunus mit Falkenstein“, Ölgemälde, 1852, u. a.) und im Städel Museum.
H. und seine Frau wurden auf dem Alten Friedhof in Bockenheim begraben.
1879 fand eine Gedenkausstellung mit Werken (Zeichnungen, Studien und Kartons) von H. und einem von der Tochter Emma H. gemalten Ölporträt des Künstlers im Städelschen Kunstinstitut statt.
Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Gudrun Jäger.
Lexika: Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. 119 Bde. (zuzüglich Index-, Register- und Nachtragsbände). Leipzig u. a. 1983/92-2023.Carsten Roth in: AKL 71 (2011), S. 40f. | Dessoff, Albert: Kunst und Künstler in Ffm. im 19. Jahrhundert. 2. Bd.: Biographisches Lexikon der Ffter Künstler im 19. Jahrhundert. Ffm. 1909.Dessoff, S. 54f. | Kaulen, Wilhelm: Freud’ und Leid im Leben deutscher Künstler. Ffm. 1878.Kaulen, S. 314-317. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 232. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 104. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 16 (1923), S. 231f.
Literatur: Eiling, Alexander/Höllerer, Eva-Maria/Schamschula, Aude-Line (Hg.): Städel / Frauen. Künstlerinnen zwischen Fft. und Paris um 1900. München 2024.Schamschula, Aude-Line: „Ohne Unterschied des Geschlechts“? Die Künstlerinnenausbildung am Städel vor 1923. In: Eiling u. a. (Hg.): Städel / Frauen 2024, S. 86-107, hier S. 87, 92. | Museum Giersch der Goethe-Universität (Hg.): Romantik im Rhein-Main-Gebiet. Katalogredaktion: Mareike Hennig, Manfred Großkinsky, Birgit Sander, Susanne Wartenberg, Linda Baumgartner. Petersberg 2015.Kat. Romantik im Rhein-Main-Gebiet 2015, S. 16, 206-208, 270, 280. | Opper, Uwe (Hg.): Die Kronberger Malerkolonie und befreundete Ffter Künstler. [Text:] Andrea Weber-Mittelstaedt. Kronberg im Taunus 2008.Opper (Hg.)/Weber-Mittelstaedt: Die Kronberger Malerkolonie u. befreundete Ffter Künstler 2008, S. 85. | Holzinger, Ernst (Hg.)/Ziemke, Hans-Joachim (Bearb.): Die Gemälde des 19. Jahrhunderts. Text- und Bildband. Ffm. 1972. (Kataloge der Gemälde im Städel’schen Kunstinstitut I).Städelkat. d. Gemälde d. 19. Jh.s 1972, Textband, S. 145f. | Wiederspahn, August/Bode, Helmut: Die Kronberger Malerkolonie. Ein Beitrag zur Ffter Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Mit dokumentarischen Beiträgen von Änne Rumpf-Demmer, Julius Neubronner und Philipp Franck. 3., erw. Aufl. Ffm. 1982.Wiederspahn/Bode: Kronberger Malerkolonie 1982, S. 213, 691.
Quellen: Ffter Rundschau. Ffm. 1945-heute.A. Kr. [d. i. August Kruhm]: Maler des Taunus. In: FR, 3.5.1962. | Ffter Zeitung und Handelsblatt. (Ffter Handelszeitung.) / (Neue Ffter Zeitung.) Ffm. 1866-1943.Nachruf in: FZ, Nr. 156, 5.6.1878, Morgenblatt, Beilage, S. 1. | Ffter Zeitung und Handelsblatt. (Ffter Handelszeitung.) / (Neue Ffter Zeitung.) Ffm. 1866-1943.Notiz zur Gedenkausstellung im Städelschen Kunstinstitut in: FZ, Nr. 131, 11.5.1879, Morgenblatt, S. 3. | ISG, Bestand Chroniken mit chronikalischen Schriften aller Art (Zeugenschrifttum wie Annalen, Tagebücher, Erlebnisberichte, Memoiren, Denkschriften), 1034-heute; erschlossen über Archivdatenbank.Heerdt, Emma: Erinnerungen. Manuskript, 1927. ISG, Chroniken, S5/239. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/854. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/9.068 (Familie Delkeskamp-Heerdt). | ISG, Standesamt (Best. A.34.02), Personenstandsunterlagen, 1874-1992.ISG, Standesamt, Familienattestat H 489 (Heerdt, Clemens). | ISG, Standesamt (Best. A.34.02), Personenstandsunterlagen, 1874-1992.ISG, Standesamt, Familienattestat H 1926 (Heerdt, Johann Christian). | Neue Ffter Zeitung. Ffm. 1859-66.Notiz zum Ankauf eines Gemäldes von Johann Christian Heerdt durch die Württembergische Staatsgalerie in Stuttgart in: NFZ, Feuilleton, Nr. 74, 28.3.1863, S. 296.
Internet: Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/1024181707Hess. Biografie, 9.10.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/heerdt-christian
Hinweis: Eintrag zu Johann Christian Heerdt in der digitalen Sammlung.Städel, 9.10.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_HeerdtWikipedia, 9.10.2025.
GND: 1024181707 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).
© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den
Autoren
Empfohlene Zitierweise:
Jäger, Gudrun: Heerdt, Johann Christian. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/10085
Stand des Artikels: 5.12.2025
Erstmals erschienen in Monatslieferung: 10.2025.

